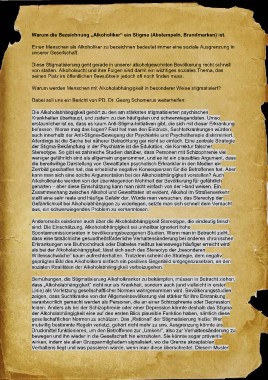Page 17 - 3 Mr.Ethanol_Neat
P. 17
Warum die Bezeichnung „Alkoholiker“ ein Stigma (Abstempeln, Brandmarken) ist.
Einen Menschen als Alkoholiker zu bezeichnen bedeutet immer eine soziale Ausgrenzung in
unserer Gesellschaft.
Diese Stigmatisierung geht gerade in unserer alkoholgewohnten Bevölkerung recht schnell
von statten. Alkoholsucht und ihre Folgen sind damit ein wichtiges soziales Thema, das
seinen Platz im öffentlichen Bewußtsein jedoch oft noch finden muss.
Warum werden Menschen mit Alkoholabhängigkeit in besonderer Weise stigmatisiert?
Dabei soll uns ein Bericht von PD. Dr. Georg Schomerus weiterhelfen:
Die Alkoholabhängigkeit gehört zu den am stärksten stigmatisierten psychischen
Krankheiten überhaupt, und zudem zu den häufigsten und schwerwiegendsten. Umso
erstaunlicher ist es, dass es kaum Anti-Stigma-Initiativen gibt, die sich mit dieser Erkrankung
befassen. Woran mag das liegen? Fast hat man den Eindruck, Suchterkrankungen würden
auch innerhalb der Anti-Stigma-Bewegung der Psychiatrie und Psychotherapie diskriminiert.
Allerdings ist die Sache bei näherer Betrachtung gar nicht so einfach. Eine zentrale Strategie
der Stigma-Bekämpfung in der Psychiatrie ist die Edukation, die Korrektur falscher
Stereotype. So gibt es zahlreiche Studien darüber, dass Personen mit Schizophrenie viel
weniger gefährlich sind als allgemein angenommen, und es ist ein plausibles Argument, dass
die bereitwillige Darstellung von Gewalttaten psychotisch Erkrankter in den Medien ein
Zerrbild geschaffen hat, das erhebliche negative Konsequenzen für die Betroffenen hat. Aber
kann man sich eine solche Argumentation bei der Alkoholabhängigkeit vorstellen? Auch
Alkoholkranke werden von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung für gefährlich
gehalten – aber diese Einschätzung kann man nicht einfach von der Hand weisen. Ein
Zusammenhang zwischen Alkohol und Gewalttaten ist evident, Alkohol im Straßenverkehr
stellt eine sehr reale und häufige Gefahr dar. Würde man versuchen, das Stereotyp der
Gefährlichkeit bei Alkoholabhängigen zu widerlegen, setzte man sich schnell dem Verdacht
aus, ein schwerwiegendes Problem zu verharmlosen.
Andererseits existieren auch über die Alkoholabhängigkeit Stereotype, die eindeutig falsch
sind: Die Einschätzung, Alkoholabhängigkeit sei unheilbar ignoriert hohe
Spontanremissionsraten in bevölkerungsbezogenen Studien. Wenn man in Betracht zieht,
dass eine tatsächliche gesundheitsförderliche Verhaltensänderung bei anderen chronischen
Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes mellitus keineswegs häufiger erreicht wird
als bei der Alkoholabhängigkeit, lässt sich auch das Stereotyp der „besonderen
Willensschwäche” kaum aufrechterhalten. Trotzdem scheint die Strategie, dem negativ
geprägten Bild des Alkoholikers einfach ein positives Gegenbild entgegenzusetzen, an den
sozialen Realitäten der Alkoholabhängigkeit vorbeizugehen.
Bemühungen, die Stigmatisierung Alkoholkranker zu bekämpfen, müssen in Betracht ziehen,
dass „Alkoholabhängigkeit” nicht nur als Krankheit, sondern auch (und vielleicht in erster
Linie) als Verletzung gesellschaftlicher Normen wahrgenommen wird. Bevölkerungsstudien
zeigen, dass Suchtkranke von der Allgemeinbevölkerung viel stärker für ihre Erkrankung
verantwortlich gemacht werden als Personen, die an einer Schizophrenie oder Depression
leiden. Anders als bei der Schizophrenie oder einer Depression könnte deshalb das Stigma
der Alkoholabhängigkeit eine auf den ersten Blick plausible Funktion haben, nämlich diese
gesellschaftlichen Normen zu schützen. Das „Rational” der Stigmatisierung hieße: Wer
mutwillig bestimmte Regeln verletzt, gehört nicht mehr zu uns. Ausgrenzung könnte als
Druckmittel funktionieren, um den Betroffenen zur „Umkehr”, also zur Verhaltensänderung zu
bewegen und ihn wieder in die Gesellschaft hin einzuholen. Sie könnte sogar präventiv
wirken, indem sie allen Gruppenmitgliedern signalisiert, wo die Grenze akzeptablen
Verhaltens liegt und was passieren würde, wenn man diese überschreitet. Diesem Muster