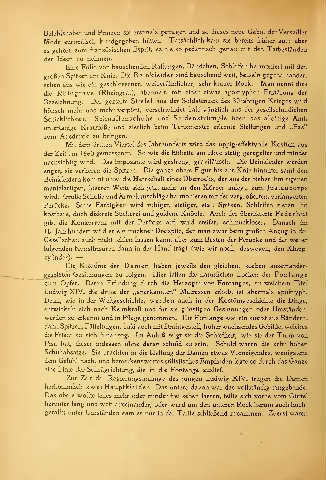Page 25 - Geschichte des Kostüms
P. 25
Befehlshaber und Prinzen sie erstmals getragen und so dieses neue Gebot der Versailler
Mode europäisch kundgegeben hätten. Tatsächlich kam sie bereits früher auf; aber
es gehört zum französischen Esprit, es nie so pedantisch genau mit den Tatbeständen
der Ideen zu nehmen.
Eine Fülle von bauschenden Raffungen, Bändchen, Schleifen harmoniert mit den
großen Spitzen am Knie. Die Beinkleider sind bauschend weit, beuteln gegeneinander,
sehen aus wie ein geschlossener, weiberähnlicher, sehr kurzer Rock. Man nennt dies
die Rhingravc (Rheingraf), abermals mit einer etwas apokryphen Erklärung der
Bezeichnung. Der gezierte Stiefel aus der Soldatenzeit des 30 jährigen Krieges wird
höfisch mehr und mehr verpönt, verschwindet bald gänzlich aus der gesellschaftlichen
Schicklichkeit. Schnallenschuhe und Seidenstrümpfe üben das alleinige Amt,
untertänige Kratzfüße und zierlich beim Tanzmeistcr erlernte Stellungen und „Pas"
zum Ausdruck zu bringen.
Mit dem dritten Viertel des Jahrhunderts wird das üppig-effektvolle Kostüm aus
der Zeit um 1660 gemessener. So wie die Etikette am Hofe stetig geregelter und minder
nachsichtig wird. Das Imposante wird gestreng, gravitätisch. Die Beinkleider werden
enger, sie verlieren die Spitzen. Die ganze obere Figur bis ans Knie hinunter samt den
Beinkleidern kommt unter die Herrschaft eines Überrocks, der aus der bisher ihm eigenen
mantclartigen, loseren Weite sich jetzt mehr an den Körper anlegt, zum Justaucorps
wird. Große Schöße und Ärmelumschläge harmonieren mit der vergrößerten, verlängerten
Perücke. Seine Farbigkeit wird ruhiger, stetiger, statt Spitzen, Schleifen zieren ihn
kostbare, doch diskrete Stickerei und goldene Knöpfe. Auch der überlieferte Federhut
gibt die Konkurrenz mit der Perücke auf, wird steifer, schmuckloser. Danach im
18. Jahrhundert wird er ein trockner Dreispitz, den man zwar beim großen Anzug in der
Gesellschaft auch nicht fehlen lassen kann, aber zum Besten der Perücke und der weiter
folgenden Kunstfrisuren dann in der Hand trägt (wie wir noch, deswegen, den Klapp-
—
zylinder).
Die Kostüme der Damen haben jeweils den gleichen, soeben auseinander-
gesetzFen Gesinnungen zu folgen. Hier fallen die natürlichen Locken der Fontange
zum Opfer. Deren Erfindung durch die Herzogin von Fontanges, zu welchem Titel
Ludwig XIV, die dritte der „anerkannten" Mätressen erhob, ist abermals apokryph.
Denn, wie in der Weltgeschichte, werden auch in der Kostümgeschichtc die Dinge,
entwickeln sich nach Keimkraft und für sie günstigen Gesinnungen oder Umständen,
werden so erkannt und in Pflege genommen. Die Fontange war ein zuerst aus Bändern,
dann Spitzen, Fältelungen, bald auch mit Drahtgestell, höher wachsendes Gebilde, welches
die Frisur zu sich hinanzog. Im Aufriß zeigt sie die Schiefheit, wie sie der Turm von
Pisa hat, dieser indessen ohne daran schuld zu sein. Schuld waren die sehr hohen
Schuhabsätze. Sie brachten in die Haltung der Damen etwas Vorneigendes, wenigstens
dem Gefühl nach, und bemerkenswertes stilistisches Empfinden legte so durch das Ganze
eine Linie der Schrägrichtung, die in die Fontange auslief.
Zur Zeit der Regierungsanfänge des jungen Ludwig XIV. trugen die Damen
herkömmlich zwei Hauptkleider. Das untere davon war das vollständig umgebende.
Das obere wollte jenes mehr oder minder frei sehen lassen, teilte sich vorne vom Gürtel
herunter lang und weit auseinander, oder ward um den unteren Rock herum auch hoch-
gerafft; unter Umständen kam es nur in der Taille schließend zusammen. Zuerst waren