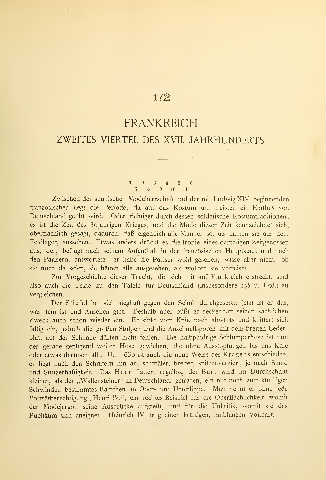Page 22 - Geschichte des Kostüms
P. 22
172
FRANKREICH
ZWEITES VIERTEL DES XVII. JAHRHUNDERTS
12 3 4 5 6
7 8 9 10 11
Zwischen der spanischen Modeherrschaft und der mit Ludwig XIV. beginnenden
französischen liegt die Periode, da auf das Kostüm am meisten ein Einfluß von
Deutschland geübt wird. Oder richtiger durch dessen soldatische Kostümtraditionen;
es ist die Zeit des Sojährigen Krieges, und die Mode dieser Zeit kennzeichnet sich,
oberflächlich gesagt, dadurch, daß eigentlich alle Männer so, als kämen sie aus dem
Feldlager, aussehen. Etwas anders drückt es die Ironie eines damaligen Zeitgenossen
aus, der, befragt nach seinem Aufenthalt in der französischen Hauptstadt und nach
den Parisern, antwortete: er habe die Pariser wohl gesehen, wisse aber nicht, ob
sie noch da seien, sie hätten alle ausgesehen, als wollten sie verreisen.
Zur Vorgeschichte dieser Tracht, die sich mit auf Frankreich erstreckt, sind
also auch die Texte zu den Tafeln für Deutschland (insbesondere 19 5 u. flgd.) zu
vergleichen.
Der Stiefel hat sich sieghaft gegen den Schuh durchgesetzt; jetzt ist er das,
was fein ist und Ansehen gibt. Deshalb aber büßt er geckenhaft seinen sachHchen
Zweck auch schon wieder ein. Er sinkt vom Knie nach abwärts und knittert sich
faltig ein, jedoch die großen Stulpen und die Anschnallsporen mit dem breiten Leder-
blatt auf der Schnalle dürfen nicht fehlen. Die halbpludrige Schlumperhose ist nun
der gerade genügend weiten Hose gewichen, die ohne Ausstopfungen bis ans Knie
oder etwas darüber fällt. Um i63o ist auch die neue Weise des Kragens entschieden,
er liegt nach den Schultern hin an, schmäler, breiter, spitzenverziert, je nach Stand
und Stutzerhaftigkeit. Das Haar flattert regellos, der Bart wird im Durchschnitt
kleiner, als der ,,Wallensteiner" in Deutschland, getragen, ein nur noch zum künftigen
Schwinden bestimmtes Bärtchen an Ober- und Unterlippe. Man nennt es ohne jede
Porträtberechtigung „Henri IV.", ein rechtes Beispiel für die Oberflächlichkeit, womit
der Modejargon seine Ausdrücke aufgreift, und für die Unkritik, womit sie das
Publikum sich aneignet. Heinrich IV. trug einen, kräftigen, halblangen Vollbart.