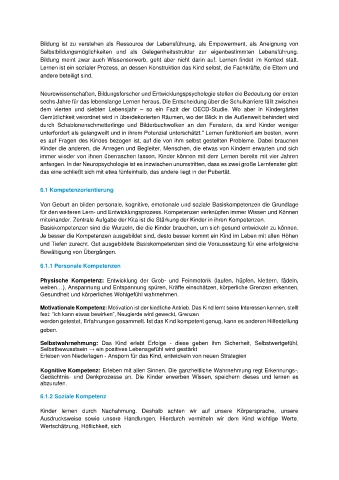Page 3 - Der bayerische Bildungs- und Erziehungsplanund dessen Umsetzung
P. 3
Bildung ist zu verstehen als Ressource der Lebensführung, als Empowerment, als Aneignung von
Selbstbildungsmöglichkeiten und als Gelegenheitsstruktur zur eigenbestimmten Lebensführung.
Bildung meint zwar auch Wissenserwerb, geht aber nicht darin auf. Lernen findet im Kontext statt.
Lernen ist ein sozialer Prozess, an dessen Konstruktion das Kind selbst, die Fachkräfte, die Eltern und
andere beteiligt sind.
Neurowissenschaften, Bildungsforscher und Entwicklungspsychologie stellen die Bedeutung der ersten
sechs Jahre für das lebenslange Lernen heraus. Die Entscheidung über die Schulkarriere fällt zwischen
dem vierten und siebten Lebensjahr – so ein Fazit der OECD-Studie. Wo aber in Kindergärten
Gemütlichkeit verordnet wird in überdekorierten Räumen, wo der Blick in die Außenwelt behindert wird
durch Schablonenschmetterlinge und Bilderbuchwolken an den Fenstern, da sind Kinder weniger
unterfordert als gelangweilt und in ihrem Potenzial unterschätzt.“ Lernen funktioniert am besten, wenn
es auf Fragen des Kindes bezogen ist, auf die von ihm selbst gestellten Probleme. Dabei brauchen
Kinder die anderen, die Anregen und Begleiter, Menschen, die etwas von Kindern erwarten und sich
immer wieder von ihnen überraschen lassen. Kinder können mit dem Lernen bereits mit vier Jahren
anfangen. In der Neuropsychologie ist es inzwischen unumstritten, dass es zwei große Lernfenster gibt:
das eine schließt sich mit etwa fünfeinhalb, das andere liegt in der Pubertät.
6.1 Kompetenzorientierung
Von Geburt an bilden personale, kognitive, emotionale und soziale Basiskompetenzen die Grundlage
für den weiteren Lern- und Entwicklungsprozess. Kompetenzen verknüpfen immer Wissen und Können
miteinander. Zentrale Aufgabe der Kita ist die Stärkung der Kinder in ihren Kompetenzen.
Basiskompetenzen sind die Wurzeln, die die Kinder brauchen, um sich gesund entwickeln zu können.
Je besser die Kompetenzen ausgebildet sind, desto besser kommt ein Kind im Leben mit allen Höhen
und Tiefen zurecht. Gut ausgebildete Basiskompetenzen sind die Voraussetzung für eine erfolgreiche
Bewältigung von Übergängen.
6.1.1 Personale Kompetenzen
Physische Kompetenz: Entwicklung der Grob- und Feinmotorik (laufen, hüpfen, klettern, fädeln,
weben…), Anspannung und Entspannung spüren, Kräfte einschätzen, körperliche Grenzen erkennen,
Gesundheit und körperliches Wohlgefühl wahrnehmen.
Motivationale Kompetenz: Motivation ist der kindliche Antrieb. Das Kind lernt seine Interessen kennen, stellt
fest: “ich kann etwas bewirken”, Neugierde wird geweckt, Grenzen
werden getestet, Erfahrungen gesammelt. Ist das Kind kompetent genug, kann es anderen Hilfestellung
geben.
Selbstwahrnehmung: Das Kind erlebt Erfolge - diese geben ihm Sicherheit, Selbstwertgefühl,
Selbstbewusstsein → ein positives Lebensgefühl wird gestärkt
Erleben von Niederlagen - Ansporn für das Kind, entwickeln von neuen Strategien
Kognitive Kompetenz: Erleben mit allen Sinnen. Die ganzheitliche Wahrnehmung regt Erkennungs-,
Gedächtnis- und Denkprozesse an. Die Kinder erwerben Wissen, speichern dieses und lernen es
abzurufen.
6.1.2 Soziale Kompetenz
Kinder lernen durch Nachahmung. Deshalb achten wir auf unsere Körpersprache, unsere
Ausdrucksweise sowie unsere Handlungen. Hierdurch vermitteln wir dem Kind wichtige Werte.
Wertschätzung, Höflichkeit, sich