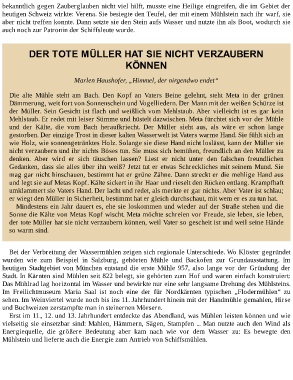Page 26 - Brot backen - wie es nur noch wenige können
P. 26
bekanntlich gegen Zauberglauben nicht viel hilft, musste eine Heilige eingreifen, die im Gebiet der
heutigen Schweiz wirkte: Verena. Sie besiegte den Teufel, der mit einem Mühlstein nach ihr warf, sie
aber nicht treffen konnte. Dann setzte sie den Stein aufs Wasser und nutzte ihn als Boot, wodurch sie
auch noch zur Patronin der Schiffsleute wurde.
DER TOTE MÜLLER HAT SIE NICHT VERZAUBERN
KÖNNEN
Marlen Haushofer, „Himmel, der nirgendwo endet“
Die alte Mühle steht am Bach. Den Kopf an Vaters Beine gelehnt, steht Meta in der grünen
Dämmerung, weit fort von Sonnenschein und Vogelliedern. Der Mann mit der weißen Schürze ist
der Müller. Sein Gesicht ist flach und weißlich vom Mehlstaub. Aber vielleicht ist es gar kein
Mehlstaub. Er redet mit leiser Stimme und hüstelt dazwischen. Meta fürchtet sich vor der Mühle
und der Kälte, die vom Bach heraufkriecht. Der Müller sieht aus, als wäre er schon lange
gestorben. Der einzige Trost in dieser kalten Wasserwelt ist Vaters warme Hand. Sie fühlt sich an
wie Holz, wie sonnengetränktes Holz. Solange sie diese Hand nicht loslässt, kann der Müller sie
nicht verzaubern und ihr nichts Böses tun. Sie muss sich bemühen, freundlich an den Müller zu
denken. Aber wird er sich täuschen lassen? Liest er nicht unter den falschen freundlichen
Gedanken, dass sie alles über ihn weiß? Jetzt tut er etwas Schreckliches mit seinem Mund. Sie
mag gar nicht hinschauen, bestimmt hat er grüne Zähne. Dann streckt er die mehlige Hand aus
und legt sie auf Metas Kopf. Kälte sickert in ihr Haar und rieselt den Rücken entlang. Krampfhaft
umklammert sie Vaters Hand. Der lacht und redet, als merkte er gar nichts. Aber Vater ist schlau;
er wiegt den Müller in Sicherheit, bestimmt hat er gleich durchschaut, mit wem er es zu tun hat.
Mindestens ein Jahr dauert es, ehe sie loskommen und wieder auf der Straße stehen und die
Sonne die Kälte von Metas Kopf wischt. Meta möchte schreien vor Freude, sie leben, sie leben,
der tote Müller hat sie nicht verzaubern können, weil Vater so gescheit ist und weil seine Hände
so warm sind.
Bei der Verbreitung der Wassermühlen zeigen sich regionale Unterschiede. Wo Klöster gegründet
wurden wie zum Beispiel in Salzburg, gehörten Mühle und Backofen zur Grundausstattung. Im
heutigen Stadtgebiet von München entstand die erste Mühle 957, also lange vor der Gründung der
Stadt. In Kärnten sind Mühlen seit 822 belegt, sie gehörten zum Hof und waren einfach konstruiert:
Das Mühlrad lag horizontal im Wasser und bewirkte nur eine sehr langsame Drehung des Mühlsteins.
Im Freilichtmuseum Maria Saal ist noch eine der für Nordkärnten typischen „Flodermühlen“ zu
sehen. Im Weinviertel wurde noch bis ins 11. Jahrhundert hinein mit der Handmühle gemahlen, Hirse
und Buchweizen zerstampfte man in steinernen Mörsern.
Erst im 11., 12. und 13. Jahrhundert entdeckte das Abendland, was Mühlen leisten können und wie
vielseitig sie einsetzbar sind: Mahlen, Hämmern, Sägen, Stampfen ... Man nutzte auch den Wind als
Energiequelle, die größere Bedeutung aber kam nach wie vor dem Wasser zu: Es bewegte den
Mühlstein und lieferte auch die Energie zum Antrieb von Schiffsmühlen.