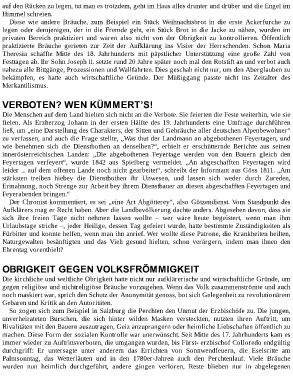Page 47 - Brot backen - wie es nur noch wenige können
P. 47
auf den Rücken zu legen, tut man es trotzdem, geht im Haus alles drunter und drüber und die Engel im
Himmel schreien.
Diese wie andere Bräuche, zum Beispiel ein Stück Weihnachtsbrot in die erste Ackerfurche zu
legen oder demjenigen, der in die Fremde geht, ein Stück Brot in die Jacke zu nähen, wurden im
privaten Bereich praktiziert und waren also nicht von der Obrigkeit zu kontrollieren. Öffentlich
praktizierte Bräuche gerieten zur Zeit der Aufklärung ins Visier der Herrschenden. Schon Maria
Theresia schaffte Mitte des 18. Jahrhunderts mit päpstlicher Unterstützung eine große Zahl von
Festtagen ab. Ihr Sohn Joseph II. setzte rund 20 Jahre später noch mal den Rotstift an und verbot auch
nahezu alle Bittgänge, Prozessionen und Wallfahrten. Dies geschah nicht nur, um den Aberglauben zu
bekämpfen, es hatte auch wirtschaftliche Gründe. Der Müßiggang passte nicht ins Zeitalter des
Merkantilismus.
VERBOTEN? WEN KÜMMERT’S!
Die Menschen auf dem Land hielten sich nicht an die Verbote. Sie feierten die Feste weiterhin, wie sie
fielen. Als Erzherzog Johann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Umfrage durchführen
ließ, um „eine Darstellung des Charakters, der Sitten und Gebräuche aller deutschen Alpenbewohner“
zu verfassen, und auch die Frage stellte, „Was thut der Landmann an abgebothenen Feyertagen, und
wie benehmen sich die Dienstbothen an denselben?“, erhielt er erschütternde Berichte aus seinen
innerösterreichischen Landen: „Die abgebothenen Feyertage werden von den Bauern gleich den
Feyertagen verfeyert“, wurde 1842 aus Spielberg vermeldet. „An abgeschafften Feyertagen wird
leider ... auf dem offenen Lande noch nicht gearbeitet“, schreibt der Informant aus Göss 1811. „Am
stärksten treiben hiebey die Dienstbothen ihr Unwesen, und lassen sich weder durch Zureden,
Ermahnung, noch Strenge zur Arbeit bey ihrem Dienstbauer an diesen abgeschafften Feyertagen und
Feyerabenden bringen.“
Der Chronist kommentiert, es sei „eine Art Abgötterey“, also Götzendienst. Vom Standpunkt des
Aufklärers mag er Recht haben. Aber die Landbevölkerung dachte anders. Abgesehen davon, dass sie
sich ihre freien Tage nicht nehmen lassen wollte – wer wäre heute begeistert, wenn man ihm
Urlaubstage striche –, jeder Heilige, dessen Tag gefeiert wurde, hatte bestimmte Zuständigkeiten als
Fürbitter und konnte helfen, wenn man ihn anrief. Wer wollte diese Patrone, die Krankheiten heilten,
Naturgewalten besänftigten und das Vieh gesund hielten, schon verärgern, indem man ihnen den
Ehrentag vorenthielt?
OBRIGKEIT GEGEN VOLKSFRÖMMIGKEIT
Die kirchliche und weltliche Obrigkeit hatte nicht nur aufklärerische und wirtschaftliche Gründe, um
gegen religiöse und nichtreligiöse Bräuche vorzugehen. Wenn das Volk zusammenströmte und auch
noch maskiert war, sprich den Schutz der Anonymität genoss, bot sich Gelegenheit zu revolutionärem
Gebaren und Kritik an den Autoritäten.
So zogen sich zum Beispiel in Salzburg die Perchten den Unmut der Erzbischöfe zu. Die jungen,
unverheirateten Burschen, die sich hinter wilden Masken versteckten, nutzten ihren Auftritt, um
Rivalitäten mit den Bauern auszutragen, Geiz anzuprangern oder heimliche Liebschaften öffentlich zu
machen. Diese Form der sozialen Kontrolle war unerwünscht. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts kam es
immer wieder zu Auftrittsverboten, die umgangen wurden, bis Fürst- erzbischof Colloredo endgültig
durchgriff: Er untersagte unter anderem das Errichten von Sonnwendfeuern, die Eselsritte am
Palmsonntag, das Wetterläuten und in den 1780er-Jahren auch den Perchtenlauf. Viele Bräuche
wurden nun heimlich durchgeführt, andere gingen verloren, Reste blieben nur in abgelegenen