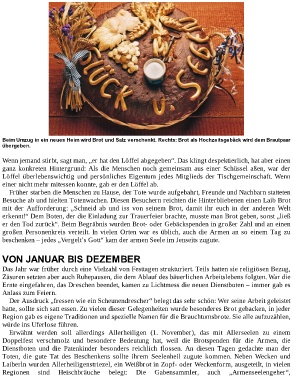Page 52 - Brot backen - wie es nur noch wenige können
P. 52
Beim Umzug in ein neues Heim wird Brot und Salz verschenkt. Rechts: Brot als Hochzeitsgebäck wird dem Brautpaar
übergeben.
Wenn jemand stirbt, sagt man, „er hat den Löffel abgegeben“. Das klingt despektierlich, hat aber einen
ganz konkreten Hintergrund: Als die Menschen noch gemeinsam aus einer Schüssel aßen, war der
Löffel überlebenswichtig und persönliches Eigentum jedes Mitglieds der Tischgemeinschaft. Wenn
einer nicht mehr mitessen konnte, gab er den Löffel ab.
Früher starben die Menschen zu Hause, der Tote wurde aufgebahrt, Freunde und Nachbarn statteten
Besuche ab und hielten Totenwachen. Diesen Besuchern reichten die Hinterbliebenen einen Laib Brot
mit der Aufforderung: „Schneid ab und iss von seinem Brot, damit ihr euch in der anderen Welt
erkennt!“ Dem Boten, der die Einladung zur Trauerfeier brachte, musste man Brot geben, sonst „ließ
er den Tod zurück“. Beim Begräbnis wurden Brot- oder Gebäckspenden in großer Zahl und an einen
großen Personenkreis verteilt. In vielen Orten war es üblich, auch die Armen an so einem Tag zu
beschenken – jedes „Vergelt’s Gott“ kam der armen Seele im Jenseits zugute.
VON JANUAR BIS DEZEMBER
Das Jahr war früher durch eine Vielzahl von Festtagen strukturiert. Teils hatten sie religiösen Bezug,
Zäsuren setzten aber auch Ruhepausen, die dem Ablauf des bäuerlichen Arbeitslebens folgten. War die
Ernte eingefahren, das Dreschen beendet, kamen zu Lichtmess die neuen Dienstboten – immer gab es
Anlass zum Feiern.
Der Ausdruck „fressen wie ein Scheunendrescher“ belegt das sehr schön: Wer seine Arbeit geleistet
hatte, sollte sich satt essen. Zu vielen dieser Gelegenheiten wurde besonderes Brot gebacken, in jeder
Region gab es eigene Traditionen und spezielle Namen für die Brauchtumsbrote. Sie alle aufzuzählen,
würde ins Uferlose führen.
Erwähnt werden soll allerdings Allerheiligen (1. November), das mit Allerseelen zu einem
Doppelfest verschmolz und besondere Bedeutung hat, weil die Brotspenden für die Armen, die
Dienstboten und die Patenkinder besonders reichlich flossen. An diesen Tagen gedachte man der
Toten, die gute Tat des Beschenkens sollte ihrem Seelenheil zugute kommen. Neben Wecken und
Laiberln wurden Allerheiligenstriezel, ein Weißbrot in Zopf- oder Weckenform, ausgeteilt, in vielen
Regionen sind Heischbräuche belegt: Die Gabensammler, auch „Armenseelengeher“,