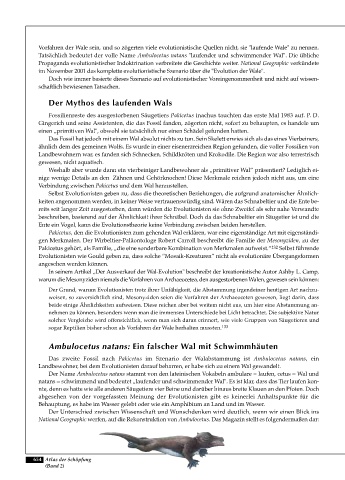Page 656 - Atlas der Schöpfung 2
P. 656
Vorfahren der Wale sein, und so zögerten viele evolutionistische Quellen nicht, sie "laufende Wale" zu nennen.
Tatsächlich bedeutet der volle Name Ambulocetus natans "laufender und schwimmender Wal". Die übliche
Propaganda evolutionistischer Indoktrination verbreitete die Geschichte weiter. National Geographic verkündete
im November 2001 das komplette evolutionistische Szenario über die "Evolution der Wale".
Doch wie immer basierte dieses Szenario auf evolutionistischer Voreingenommenheit und nicht auf wissen-
schaftlich bewiesenen Tatsachen.
Der Mythos des laufenden Wals
Fossilienreste des ausgestorbenen Säugetiers Pakicetus inachus tauchten das erste Mal 1983 auf. P. D.
Gingerich und seine Assistenten, die das Fossil fanden, zögerten nicht, sofort zu behaupten, es handele um
einen „primitiven Wal", obwohl sie tatsächlich nur einen Schädel gefunden hatten.
Das Fossil hat jedoch mit einem Wal absolut nichts zu tun. Sein Skelett erwies sich als das eines Vierbeiners,
ähnlich dem des gemeinen Wolfs. Es wurde in einer eisenerzreichen Region gefunden, die voller Fossilien von
Landbewohnern war, es fanden sich Schnecken, Schildkröten und Krokodile. Die Region war also terrestrisch
gewesen, nicht aquatisch.
Weshalb aber wurde dann ein vierbeiniger Landbewohner als „primitiver Wal” präsentiert? Lediglich ei-
nige wenige Details an den Zähnen und Gehörknochen! Diese Merkmale reichen jedoch nicht aus, um eine
Verbindung zwischen Pakicetus und dem Wal herzustellen.
Selbst Evolutionisten geben zu, dass die theoretischen Beziehungen, die aufgrund anatomischer Ähnlich-
keiten angenommen werden, in keiner Weise vertrauenswürdig sind. Wären das Schnabeltier und die Ente be-
reits seit langer Zeit ausgestorben, dann würden die Evolutionisten sie ohne Zweifel als sehr nahe Verwandte
beschreiben, basierend auf der Ähnlichkeit ihrer Schnäbel. Doch da das Schnabeltier ein Säugetier ist und die
Ente ein Vogel, kann die Evolutionstheorie keine Verbindung zwischen beiden herstellen.
Pakicetus, den die Evolutionisten zum gehenden Wal erklären, war eine eigenständige Art mit eigenständi-
gen Merkmalen. Der Wirbeltier-Paläontologe Robert Carroll beschreibt die Familie der Mesonyziden, zu der
Pakicetus gehört, als Familie, „die eine sonderbare Kombination von Merkmalen aufweist.“ 132 Selbst führende
Evolutionisten wie Gould geben zu, dass solche “Mosaik-Kreaturen” nicht als evolutionäre Übergangsformen
angesehen werden können.
In seinem Artikel „Der Ausverkauf der Wal-Evolution" beschreibt der kreationistische Autor Ashby L. Camp,
warum die Mesonyziden niemals die Vorfahren von Archaeocetea, den ausgestorbenen Walen, gewesen sein können:
Der Grund, warum Evolutionisten trotz ihrer Unfähigkeit, die Abstammung irgendeiner heutigen Art nachzu-
weisen, so zuversichtlich sind, Mesonyziden seien die Vorfahren der Archaeoceten gewesen, liegt darin, dass
beide einige Ähnlichkeiten aufweisen. Diese reichen aber bei weitem nicht aus, um hier eine Abstammung an-
nehmen zu können, besonders wenn man die immensen Unterschiede bei Licht betrachtet. Die subjektive Natur
solcher Vergleiche wird offensichtlich, wenn man sich daran erinnert, wie viele Gruppen von Säugetieren und
sogar Reptilien bisher schon als Vorfahren der Wale herhalten mussten. 133
Ambulocetus natans: Ein falscher Wal mit Schwimmhäuten
Das zweite Fossil nach Pakicetus im Szenario der Walabstammung ist Ambulocetus natans, ein
Landbewohner, bei dem Evolutionisten darauf beharren, er habe sich zu einem Wal gewandelt.
Der Name Ambulocetus natans stammt von den lateinischen Vokabeln ambulare = laufen, cetus = Wal und
natans = schwimmend und bedeutet „laufender und schwimmender Wal". Es ist klar, dass das Tier laufen kon-
nte, denn es hatte wie alle anderen Säugetiere vier Beine und darüber hinaus breite Klauen an den Pfoten. Doch
abgesehen von der vorgefassten Meinung der Evolutionisten gibt es keinerlei Anhaltspunkte für die
Behauptung, es habe im Wasser gelebt oder wie ein Amphibium an Land und im Wasser.
Der Unterschied zwischen Wissenschaft und Wunschdenken wird deutlich, wenn wir einen Blick ins
National Geographic werfen, auf die Rekonstruktion von Ambulocetus. Das Magazin stellt es folgendermaßen dar:
654 Atlas der Schöpfung
(Band 2)