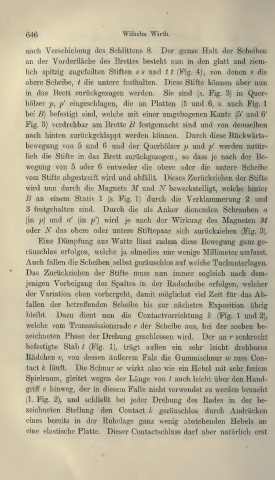Page 658 - Wilhelm Wundt zum siebzigsten Geburtstage
P. 658
646 Wilhelm Wirth.
nach Verschiebung des Schlittens 8. Der ganze Halt der Scheiben
an der Vorderfläche des Brettes besteht nun in den glatt und ziem-
lich spitzig zugefeilten Stiften s s und 1 1 (Fig. 4) , von denen s die
obere Scheibe, t die untere festhalten. Diese Stifte können aber nun
in das Brett zurückgezogen werden. Sie sind (s. Fig. 3) in Quer-
hölzer p' eingeschlagen, die an Platten s. auch Fig. 1
p, (5 und 6,
bei B) befestigt sind, welche mit einer umgebogenen Kante (5' und 6'
Fig. 3) verdrehbar am Brette B festgemacht sind und von demselben
nach hinten zurückgeklappt werden können. Durch diese Rückwärts-
bewegung von 5 und 6 und der Querhölzer p und p' werden natür-
lich die Stifte in das Brett zurückgezogen so dass je nach der Be-
,
wegung von 5 oder 6 entweder die obere oder die untere Scheibe
vom Stifte abgestreift wird und abfällt. Dieses Zurückziehen der Stifte
wird nun durch die Magnete M und N bewerkstelligt, welche hinter
B an einem Stativ 1 (s. Fig. 1) durch die Verklammerung 2 und
3 festgehalten sind. Durch die als Anker dienenden Schrauben a
(in p) und a' (in p') wird je nach der Wirkung des Magneten 31
oder N das obere oder untere Stiftepaar sich zurückziehen (Fig. 3).
Eine Dämpfung aus Watte lässt zudem diese Bewegung ganz ge-
räuschlos erfolgen, welche ja ohnedies nur wenige Millimeter umfasst.
Auch fallen die Scheiben selbst geräuschlos auf weiche Tuchunterlagen.
Das Zurückziehen der Stifte muss nun immer sogleich nach dem-
jenigen Vorbeigang des Spaltes in der Radscheibe erfolgen, welcher
der Variation eben vorhergeht, damit möglichst viel Zeit für das Ab-
fallen der betreffenden Scheibe bis zur nächsten Exposition übrig
bleibt. Dazu dient nun die Contactvorrichtung k (Fig. 1 und 2),
welche vom Transmissionsrade r der Scheibe aus, bei der soeben be-
zeichneten Phase der Drehung geschlossen wird. Der an r senkrecht
befestigte Stab t (Fig. 1), trägt außen ein sehr leicht drehbares
Rädchen v, von dessen äußerem Falz die G-ummischnur w zum Con-
tact k läuft. Die Schnur w wirkt also wie ein Hebel mit sehr freiem
Spielraum, gleitet wegen der Länge von t auch leicht über den Hand-
griff e hinweg, der in diesem Falle nicht verwendet zu werden braucht
(1. Fig. 2), und schließt bei jeder Drehung des Rades in der be-
zeichneten Stellung den Contact k geräuschlos durch Andrücken
eines bereits in der Ruhelage ganz wenig abstehenden Hebels an
eine elastische Platte. Dieser Contactschluss darf aber natürlich erst