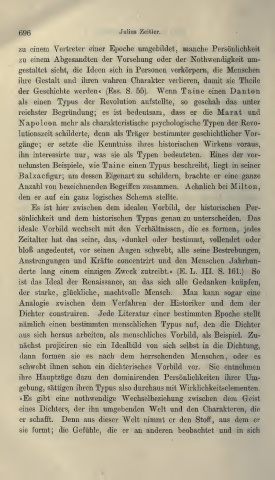Page 708 - Wilhelm Wundt zum siebzigsten Geburtstage
P. 708
696 Julius Zeitler.
ZU einem Vertreter einer Epoche umgebildet, manche Persönlichkeit
zu einem Abgesandten der Vorsehung oder der Nothwendigkeit um-
gestaltet sieht, die Ideen sich in Personen verkörpern, die Menschen
ihre Gestalt und ihren wahren Charakter verlieren, damit sie Theile
der Geschichte werden« (Ess. S. 55). Wenn Taine einen Danton
als einen Typus der Revolution aufstellte, so geschah das unter
reichster Begründung; es ist bedeutsam, dass er die Marat und
Napoleon mehr als charakteristische psychologische Typen der Revo-
lutionszeit schilderte, denn als Träger bestimmter geschichthcher Vor-
gänge; er setzte die Kenntniss ihres historischen Wirkens voraus,
ihn interessirte nur, was sie als Typen bedeuteten. Eines der vor-
nehmsten Beispiele, wie Taine einen Typus beschreibt, liegt in seiner
Balzacfigur; um dessen Eigenart zu schildern, brachte er eine ganze
Anzahl von bezeichnenden Begriffen zusammen. Aehnlich bei Milton,
den er auf ein ganz logisches Schema stellte.
Es ist hier zwischen dem idealen Vorbild, der historischen Per-
sönlichkeit und dem historischen Typus genau zu unterscheiden. Das
ideale Vorbild wechselt mit den Verhältnissen, die es formen, jedes
Zeitalter hat das seine, das, »dunkel oder bestimmt, vollendet oder
bloß angedeutet, vor seinen Augen schwebt, alle seine Bestrebungen,
Anstrengungen und Kräfte concentrirt und den Menschen Jahrhun-
derte lang einem einzigen Zweck zutreibt.« (E. L. III. S. 161.) So
ist das Ideal der Renaissance, an das sich alle Gedanken knüpfen,
der starke, glückliche, machtvolle Mensch. Man kann sogar eine
Analogie zwischen dem Verfahren der Historiker und dem der
Dichter construiren. Jede Literatur einer bestimmten Epoche stellt
nämlich einen bestimmten menschlichen Typus auf, den die Dichter
aus sich heraus arbeiten, als menschliches Vorbild, als Beispiel. Zu-
nächst projiciren sie ein Idealbüd von sich selbst in die Dichtung,
dann formen sie es nach dem herrschenden Menschen, oder es
schwebt ihnen schon ein dichterisches Vorbild vor. Sie entnehmen
ihre Hauptzüge dazu den dominirenden Persönlichkeiten ihrer Um-
gebung, sättigen ihren Typus also durchaus mit Wirklichkeitselementen.
»Es gibt eine nothwendige Wechselbeziehung zwischen dem Geist
eines Dichters, der ihn umgebenden Welt und den Charakteren, die
er schafft. Denn aus dieser Welt nimmt er den Stoff, aus dem er
sie formt; die Gefühle, die er an anderen beobachtet und in sich