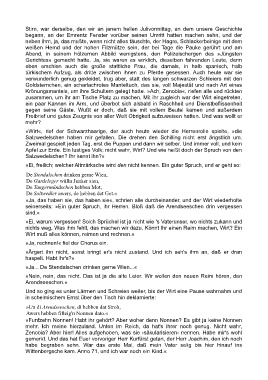Page 40 - Grete Minde
P. 40
Stirn, war derselbe, den wir an jenem hellen Julivormittag, an dem unsere Geschichte
begann, an der Emrentz Fenster vorüber seinen Umritt hatten machen sehn, und der
neben ihm, ja, das mußte, wenn nicht alles täuschte, der Hagre, Schlackerbeinige mit dem
weißen Hemd und der hohen Filzmütze sein, der bei Tage die Pauke gerührt und am
Abend, in seinem hölzernen Abbild wenigstens, den Polizeischergen des »Jüngsten
Gerichtes« gemacht hatte. Ja, sie waren es wirklich, dieselben fahrenden Leute, denn
eben erschien auch die große stattliche Frau, die damals, in halb spanisch, halb
türkischem Aufzug, als dritte zwischen ihnen zu Pferde gesessen. Auch heute war sie
verwunderlich genug gekleidet, trug aber, statt des langen schwarzen Schleiers mit den
Goldsternchen, ein scharlachrotes Manteltuch, das sie, voll Majestät und nach Art eines
Krönungsmantels, um ihre Schultern gelegt hatte. »Ach, Zenobia«, riefen alle und rückten
zusammen, um ihr am Tische Platz zu machen. Mit ihr zugleich war der Wirt eingetreten,
ein paar Kannen im Arm, und überbot sich alsbald in Raschheit und Dienstbeflissenheit
gegen seine Gäste. Wußt er doch, daß sie mit vollem Beutel kamen und außerdem
Freibrief und gutes Zeugnis von aller Welt Obrigkeit aufzuweisen hatten. Und was wollt er
mehr?
»Wirt«, rief der Schwarzhaarige, der auch heute wieder die Herrenrolle spielte, »die
Salzwedelschen haben mir gefallen. Die drehen den Schilling nicht erst ängstlich um.
Zweimal gespielt jeden Tag, erst die Puppen und dann wir selber. Und immer voll, und kein
Apfel zur Erde. Ein lustiges Volk; nicht wahr, Wirt? Und wie heißt doch der Spruch von den
Salzwedelschen? Ihr kennt ihn?«
»Ei, freilich; welcher Altmärksche wird den nicht kennen. Ein guter Spruch, und er geht so:
De Stendalschen drinken gerne Wien,
De Gardeleger wülln Junker sien,
De Tangermündschen hebben Mot,
De Soltwedler awers, de hebben dat Got.«
»Ja, das haben sie, das haben sie«, schrien alle durcheinander, und der Wirt wiederholte
seinerseits: »Ein guter Spruch, ihr Herren. Bloß daß die Arendseeschen drin vergessen
sind.«
»Ei, warum vergessen! Solch Sprüchel ist ja nicht wie 's Vaterunser, wo nichts zukann und
nichts weg. Was ihm fehlt, das machen wir dazu. Könnt Ihr einen Reim machen, Wirt? Ein
Wirt muß alles können, reimen und rechnen.«
»Ja, rechnen!« fiel der Chorus ein.
»Ärgert ihn nicht, sonst bringt er's nicht zustand. Und ich seh's ihm an, daß er dran
haspelt. Habt ihr's?«
»Ja... De Stendalschen drinken gerne Wien...«
»Nein, nein, das nicht. Das ist ja die alte Leier. Wir wollen den neuen Reim hören, den
Arendseeschen.«
Und so ging es unter Lärmen und Schreien weiter, bis der Wirt eine Pause wahrnahm und
in schelmischem Ernst über den Tisch hin deklamierte:
»Un di Arendseeschen, di hebben dat Stroh,
Awers hebben fifteig'n Nonnen dato.«
»Funfzehn Nonnen! Habt ihr gehört? Aber woher denn Nonnen? Es gibt ja keine Nonnen
mehr. Ich meine hierzuland. Unten im Reich, da hat's ihrer noch genug. Nicht wahr,
Zenobia? Aber hier! Alles aufgehoben, was sie ›säkularisieren‹ nennen. Habe mir's wohl
gemerkt. Und das hat Euer vorvoriger Herr Kurfürst getan, der Herr Joachim, den ich noch
habe begraben sehn. War das erste Mal, daß mein Vater selig bis hier hinauf ins
Wittenbergsche kam. Anno 71, und ich war noch ein Kind.«